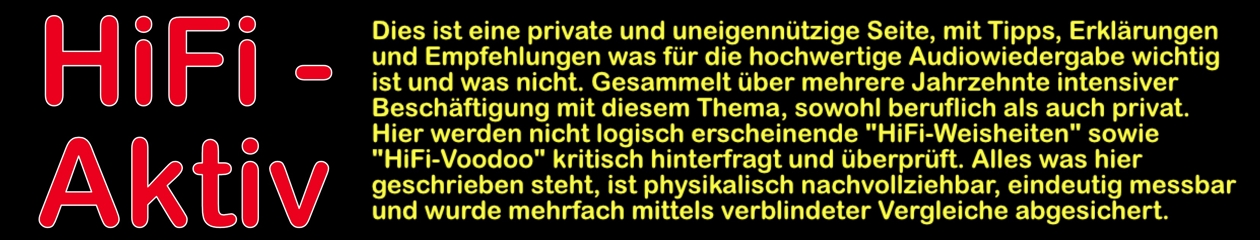Dröhnender Bass ist lästig und kann mit einfachen Mitteln nicht verhindert werden.
Wer in einschlägigen Kreisen kennt dieses Problem nicht? Lautsprecher, die auch in der Lage sind ohne viel Pegelverlust recht tiefe Frequenzen wiederzugeben, regen Raummoden (auch „stehende Wellen“ genannt) besonders stark an und diese können sehr lästig werden. Bei Verwendung von Subwoofern hat das oft ganz dramatische Auswirkungen. Freud‘ und Leid liegen hier eng beieinander. Einerseits der Hörspaß und andererseits das Gedröhne.
Dazu kommt, dass es in den wenigsten Fällen freie Wahl bezüglich der Lautsprecheraufstellung gibt und ebenso nicht was den Hörplatz betrifft. Wäre es anders, könnte man zumindest die Position des Stereodreiecks im Raum optimieren und auf diese Art die schlimmsten Moden halbwegs in den Griff bekommen. Mehr allerdings auch nicht.
Physikalisch betrachtet ist jeder Raum eine dimensionsabhängige Resonanzkammer. Je nachdem wo darin Schall entsteht und wo sich der Hörplatz- bzw. bei Messungen das Messmikrofon befindet, gibt es „gewaltige“ Frequenzberge und Frequenzlöcher, ganz besonders im Bereich der tiefen Töne. Nicht selten entstehen hier Differenzwerte im zweistelligen Dezibelbereich. Die Frequenzlöcher fallen dabei nicht so sehr auf wie die Frequenzberge, die ja die Ursache für das Gedröhne sind.
Mit Helmholtzresonatoren (quasi Bassreflexboxen ohne eingebauten Laprecherchassis) und Plattenresonatoren kann man durchaus Verbesserungen erzielen, aber beides arbeitet nur in einem bestimmten schmalen Frequenzbereich und dazu noch mit begrenzter Absorbtionsleistung. Das große „Wunder“ passiert damit jedenfalls nicht. Für gute Wirksamkeit müssten Helmholtzresonatoren mindestens so groß sein wie die Lautsprecher selbst. Plattenresonatoren wirken erst, wenn sie einige Quadratmeter groß sind. Mit „passiven“ Methoden lassen sich meterlange Wellen nur wenig beeinflussen.
Reale Möglichkeiten im „Aktivbereich“ (Room-Equalizing):
Zuerst einmal muss man sich dessen bewusst sein, dass man nicht die geringste Chance hat (es sei denn mit „Unmengen“ von Subwoofern im Raum) Raummoden überall im Raum zu verhindern. Man kann nur einen Punkt festlegen (in den meisten Fällen wird das der vorgesehene Hörplatz sein), den es zu optimieren gilt.
Schon einen Meter daneben stimmt dann kaum noch etwas.
Drei Möglichkeiten gibt es:
1.) Die primitivste, aber leider auch am wenigsten perfekte ist die, die ganze Sache einem automatischen Einmesssystem, wie es heute fast jeder A/V-Receiver (und zunehmend immer mehr Stereoverstärker) beinhaltet, zu überlassen. Hier wurden in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt.
2.) Schon wesentlich besser, weil ein externes Spezialgerät nur für diesen Zweck, ist ein „Anti Mode“ vom Hersteller DSPeaker.
Es gibt mehrere Modelle davon, je nach Bedarf. Am besten ist es, dazu mit dem Stützpunkthändler zu reden, denn der kennt sich damit am besten aus. So einen gibt es auch in Deutschland.
3.) Nicht automatisierte aktive Maßnahmen:
Nicht automatisiert, das heisst, man muss schon sehr genau wissen was man da macht. Und weiter noch, man muss „akustisch messen können“, denn sonst tappt man dabei sozusagen „im Dunkel“.
Aber! Das was man auf diese Art erreichen kann, das kommt dem möglichen Optimum schon sehr nahe. So arbeiten Profis in Studios und so werden vollaktive Lautsprecher abgestimmt – bzw. an den Raum angepasst, in dem sie letztlich arbeiten.
Was ist dazu notwendig?
Zuerst einmal muss man messen was sich beim Hörplatz abspielt, wo sich also die Problemstellen befinden und wie groß sie sind.
Dazu benötigt man weniger als allgemein angenommen wird. Auf Seite der Hardware genügt fast jeder PC, denn der Rechenaufwand ist hier recht gering, so wie bei der Audiowiedergabe auch.
Zusätzlich benötigt man ein Messmikrofon. Lange Zeit gab es nur Kondensatormikrofone, die zur Funktion eine „Phantomspeisung“ benötigt haben. Dazu gab es sogenannte Audio-Interfaces (ab ca. 60 Euro erhältlich).
Seit wenigen Jahren gibt es Mikrofone (viel praktischer und genau so gut), die direkt an einen USB-Eingang des PC’s angeschlossen werden, allen voran das vom chinesischen Herstellet miniDSP um knapp über 100 Euro.
Bei der Software wird es noch einfacher: sehr bekannt und sehr bewährt hat sich „ARTA“, das man auch „freeware“ bekommt. Die lizenzierte Variante bietet kaum etwas, das man als „Normalmensch“ wirklich braucht. Leider gibt es dieses Programm nur für Windows und nicht für das AppleBetriebssystem.
Sowohl für Apple als auch für Windows gibt es das kostenlose „Audionet Carma“. Mir gefällt es fast noch besser als ARTA, weil es recht einfach zu bedienen ist und trotzdem alles beinhaltet das man braucht.
An dieser Stelle der wichtigste Tipp überhaupt, weil ich immer wieder davon erfahre, dass das falsch gemacht und nicht verstanden wird: immer nur einen Lautsprecher pro Messdurchgang messen, denn sonst kommt es zu starken Verfälschungen vor allem im Hochtonbereich! Bei der Software von Carma im Stereomodus ergibt sich das von alleine, weil zuerst der linke und dann der rechte Lautsprecher gemessen wird. Nur im Monomodus werden beide Lautsprecher gleichzeitig gemessen (braucht man normaler Weise nicht).
Hat man Messungen, was dann?
Ziel ist es, den Schalldruckverlauf so gut wie möglich beim Hörplatz zu linearisieren, denn nur dann wird die Musik „halbwegs richtig“ (also ähnlich dem wie sie produziert wurde) wiedergegeben.
Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:
1.) Das Einschleifen eines analogen Equalizers wäre eine recht einfache Methode, aber mir ist aktuell kein Gerät bekannt, das vor allem im Bassbereich ausreichend viele Korrekturpunkte bietet.
2.) Ein online Equalizer, der aber dann nur bei der Wiedergabe über den PC funktioniert wäre eine gute Möglichkeit. Hier gibt es angeblich (ich kenne sie nicht) auch welche mit ausreichend vielen Korrekturpunkten. Die „besseren“ davon sind allerdings meist kostenpflichtig.
3.) Der „Königsweg“:
Ein digitaler Signalprozessor (DSP) ist der Idealfall. So ein Gerät kann alles, um Lautsprecher optimal an einen vorgegebenen Raum anzupassen. Allerdings muss man sich damit auskennen, denn ganz primitiv ist so etwas nicht.
Zweikanalige Geräte sind eher selten. Selbst die, welche nur zwei Eingänge haben, bieten zumindest vier Ausgänge bzw. Kanäle an, so wie es für die Aktivierung von Lautsprechern im Mindestfall notwendig ist. Diese vier Ausgänge sind ebenso notwendig , wenn man vorhandene passive Lautsprecher mit aktiven Subwoofern erweitern möchte. Somit passt das.
Der (bereits oben erwähnte) chinesische Hersteller miniDSP (man bekommt dessen Produkte bei vielen Händlern auf der ganzen Welt, also auch im deutschsprachigen Raum) bietet eine ganze Palette an derartigen Geräten (und darüber hinaus noch viele andersartige) an. Die dazu notwendige Einstell-Software ist immer dabei (online auf der Herstellerseite abrufbar). Seit vielen Jahren verwenden DIY-Leute dessen Produkte gerne (ich auch). Alles ist kompakt, nicht teuer und sauber gemacht. Ich wüsste momentan keine Alternative dazu. Dort gibt es auch das oben genannte USB-Mikrofon. Zu diesem Mikrofon bekommt man auf der Herstellerseite auch eine individuelle Korrektur-Datei, um die Produkt-Streuung zu korrigieren. Alles das ist recht perfekt gemacht.
Deren kleinster DSP reicht schon aus, um Lautsprecher an den Hörraum anzupassen.
Seit relativ kurzer Zeit gibt es dort die „Flex-Serie“. Sie stellt alles Bisherige in den Schatten. Dazu gibt es die automatische Einmess-App „Dirac-Live“.
In einem eigenen Artikel in dieser HP beschreibe ich deren Funktion.
————————————
Wichtig zu wissen! Vor allem im modalen Bereich (also unter ca. 250Hz) kann man nur „Berge abtragen“, aber keine „neu aufbauen“. Ein „Modenloch“ kann man nicht mittels Pegelerhöhung „füllen“.
Dazu auch noch ein zweiter Hinweis: es macht keinen Sinn, jedem „schmalen Zacken“ den Garaus machen zu wollen, weil so etwas nicht hörbar ist und auch sonst nicht stört. Hörbar sind breitbandge Einbrüche und Überhöhungen und selbst die erst ab einer bestimmten Größenordnung (ca. 2-3dB) und je nach Frequenzbereich.
————————————-
Eine weitere Möglichkeit will ich nicht unerwähnt lassen, die bevorzugt von sehr anspruchsvollen DIY-Heimkino Enthusiasten verwendet wird:
Die Sache um die es hier geht, ist etwas physikalisch völlig logisches und nichts Neues. Sie ist nur deshalb im Hifi-Bereich kein Thema, weil die Umsetzung davon in der Praxis viel zu aufwändig wäre. Das dazu notwendige Wissen hat nämlich kaum ein Händler und auch kein „üblicher“ Endverbraucher.
Um in einem Raum tiefe Töne halbwegs gleichmäßig (perfekt funktioniert das sowieso nie) wiederzugeben, muss man verhindern, dass es zu besagten Resonanzen/Moden kommt. Und das geht am besten, indem man die von den Lautsprechern abgegebenen tiefen Schallwellen, nachdem sie den Hörplatz passiert haben, sofort wieder „absaugt“. Denn was nicht mehr da ist, das kann auch nicht mehr zurückkommen/stören/dröhnen und das ist sozusagen der Trick dabei. Diese Absaugung muss hinter dem Hörplatz erfolgen. Genau genommen ist aber auch das alles Andere als perfekt, denn jeder Raum hat bekannter Weise (mindestens) drei Dimensionen. Für wirklich perfekte Tieftonwiedergabe müsste man den Aufwand somit verdreifachen, um jede Raumdimension mit einzubeziehen! Mit einzelnen Subwoofern ist so etwas fast nicht zu realisieren.
Profis lösen das auf aufwändige Art, indem sie sowohl die gesamte Frontseite eines Raumes (dort wo die Frontlautsprecher stehen) als auch die Gegenseite dazu (also die Wand hinter dem Sitzplatz) mit Tieftonlautsprechern (mittels Wandeinbau) „zupflastern“. Das ergibt pro Wand ca. 10-20 Lautsprecher, die in Serien- und Parallelschaltung sowohl physikalisch als auch elektrisch zu einer Einheit werden.
Selbstredend, dass so etwas nur in einem Raum machbar ist, der hauptsächlich der Heimkino- und/oder der Musikwiedergabe dient.
Der Aufwand und die Kosten sind nicht einmal so schlimm wie angenommen, für DIY-Leute ist so etwas durchaus machbar, wenn der gesamte Raum ohnehin schon „Baustelle“ ist.
In der Profiszene (die unvergleichlich seriöser ist und die technisch nicht wie die HiFi-Szene um mindestens ein Jahrzehnt hinterher hinkt) nennt man so etwas „Bassarray“ oder „Double Bass Array“ (abgekürzt DBA) wenn man dabei kanalgetrennt vorgeht.
Voraussetzung zur rückwärtigen Bassabsaugung:
-> hinter dem Hörplatz muss es noch viel freien Raum geben.
-> die vorderen und die rückwärtigen Subwoofer müssen gleich leistungsfähig sein.
-> die rückwärtigen Subwoofer müssen gegenphasig zu den Hauptboxen arbeiten (das funktioniert leider nicht mit der eingebauten Phasenjustage, die es bei aktiven Subwoofern gibt!).
-> alle Subwoofer müssen auf gleichen Pegel eingestellt werden und deren Lautstärke muss sowohl mit den Frontboxen als auch miteinander synchronisiert sein.
-> die Subwoofer dürfen nur bis maximal 100Hz arbeiten (minus 3db Punkt).
-> die rückwärtigen Subwoofer müssen um das Maß zeitverzögert werden, den die Schallwellen benötigten, um von vorne bis nach hinten zu gelangen.
Für diese Zeitverzögerung ist ein DSP notwendig, denn auf analoger Basis geht das nicht. Derselbe DSP kann dann gleich dazu dienen, um die Linearität im Bassbereich noch einmal zu verbessern.
Die notwendige Zeitverzögerung lässt sich ganz leicht errechnen: Abstand vom vorderen Schallentstehungspunkt bis zum Bassabsauger (in Metern) dividiert durch die Schallgeschwindigkeit (ca. 340m/sec) und schon hat man den richtigen Wert in Millisekunden. Für beispielsweise 5 Meter sind das 14,7ms.
Da es sich bei tiefen Frequenzen um meterlange Wellen handelt, geht es dabei nicht um 2-3 Dezimeter, einfaches Messen mit einem Maßband reicht völlig.
Man benötigt auch keine spezielle Einmessung per Messmikrofon und Software. Theorie und Praxis passen hier bestens zusammen.
Mir ist völlig klar, dass sich das alles recht abschreckend liest. Kaum Jemand wird so etwas im Wohnbereich machen. Hat man aber einen eigenen Hörraum zur Verfügung und strebt man möglichst perfekte Tieftonwiedergabe an, ist die Bassabsaugung eine Überlegung wert. Jedenfalls ist so etwas „tausendmal sinnvoller“ und wirkungsvoller als teure Kabel oder sonstiges umstrittenes Zeugs.